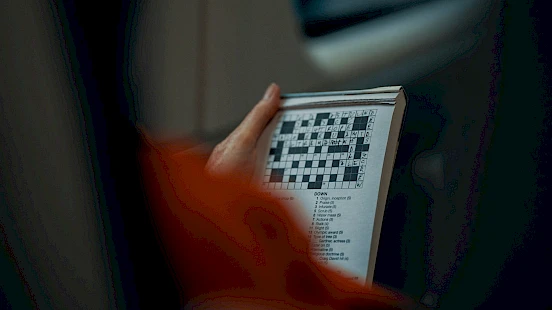Der Goldfisch hat genug – was wir über Aufmerksamkeit wirklich wissen müssen
Ich kannte mal einen Goldfisch namens Lasse. Dieser Goldfisch fühlte sich schlecht behandelt. Konferenzteilnehmer:innen, Agenturen und sogar die Vorstandsvorsitzende von nebenan – allesamt mit gefährlichem Halbwissen ausgestattet – bescheinigtem ihm eine Aufmerksamkeitsspanne von gerade einmal neun Sekunden. Das ärgerte Lasse mächtig und es tat diesem Ärger auch keinen Abbruch, dass Menschen ihren eigenen Artgenossen sogar eine noch kürzere Aufmerksamkeitsspanne, nämlich gerade einmal acht Sekunden, attestierten.
Linderung verschaffte einzig eine Recherche der BBC aus dem Jahre 2017, die zeigte, dass diese Fehlinformation auf eine unsauber referenzierte Microsoft-Studie aus dem Jahr 2015 zurückgeht. Die zugrunde gelegte Datenbasis einer allgemein so niedrigen Aufmerksamkeitsspanne ist lt. der BBC nicht nachvollziehbar und außerdem läge keine wissenschaftliche Validierung dazu vor.
Was hingegen stimmt – wohl für unseren Goldfisch als auch für uns Menschen: Aufmerksamkeit ist kontextabhängig und intentional. Menschen können sich sehr wohl über längere Zeiträume konzentrieren, nämlich dann, wenn der Fokus unserer Aufmerksamkeit zum erklärten Ziel passt, dabei relevant, glaubwürdig und gut gestaltet ist. Wie uns eine BITKOM-Studie zeigt, kann die als ideal angesehene Podcastlänge etwa auf 26 Minuten beziffert werden; wir sind also bereit für weit mehr als acht Sekunden Aufmerksamkeit. Diese ist kein knappes Gut per se, sondern eine selektiv einsetzbare Fähigkeit.
Plattformlogiken verstehen – sich aber nicht unterwerfen
Lasse steigt aufgrund eigener Gattungszugehörigkeit, eines chronischen Mangels an nutzbaren Daumen sowie seiner kognitiven Kompetenz leider bei einer Sache aus: Aktive Aufmerksamkeit schön und gut, aber reden wir doch mal über „brain rot“. Eine Metaanalyse im wissenschaftlichen Journal brain science aus März 2025 zeigt trotzdem, dass etwa die exzessive Nutzung von Social Media und anderen digitalen Plattformen mit ihren Dopamin-getriebenen Feedbackschleifen zu emotionaler Desensibilisierung, kognitiver Überlastung und einem negativen Selbstbild führt. Umstände, die eben die mentale Gesundheit angreifen und zu Depression, nachlassender Gedächtnisleistung und schwindender Aufmerksamkeit führen können.
Wäre der Goldfisch außerdem nicht so schnell abgelenkt (sorry, Lasse!), hätte auch er bei meinem Gespräch mit dem US-amerikanischen Historiker und Professor an der Princeton University D. Graham Burnett zugehört. Dieser beschreibt die Wirkweise digitaler Plattformen pointiert als „Human Fracking“ – er meint damit die systematische Extraktion menschlicher Aufmerksamkeit durch digitale Plattformen, analog der umstrittenen Erdöl-/Erdgasfördermethode. Algorithmisch strukturiert bekommen wir hohe Dosen affektgeladener Inhalte präsentiert – der nächste Scroll könnte Interessantes liefern und regt die Dopaminproduktion an. Abgebaut wird nicht Öl oder Gas, sondern Aufmerksamkeit. Die Überbleibsel dieses Abbaus: emotionale Erregung und Erschöpfung, brain rot und eine Veränderung unserer sozialen Interaktionen. Digitale Plattformen wie YouTube, LinkedIn oder Instagram funktionieren nach klaren ökonomischen Prinzipien: Aufmerksamkeit wird in ihnen zum handelbaren Gut erklärt. Je länger Nutzer:innen verweilen, desto größer ist der Werbewert. Daraus ergeben sich bestimmte Funktionslogiken: Inhalte mit hoher Emotionalisierung, starker Polarisierung und geringer Komplexität werden bevorzugt ausgespielt.
Aber: Diese Mechaniken bedeuten eben nicht automatisch kulturellen oder sozialen Verfall. Vielmehr eröffnet das Bewusstsein über deren Wirkweise Gestaltungsräume für Individuen und Organisationen, die bereit sind, die Verantwortung für die Qualität ihrer Nutzung und Kommunikation zu übernehmen. Mein entscheidender Punkt ist: Plattformen sind nicht per se schlecht oder gut. Deren exzessive Nutzung ist, aller aktuellen Datenlage nach, schädlich für das menschliche Gehirn, was aber noch nicht bedeutet, dass ein verantwortungsvoller reflektierter Umgang mit ihnen das gleiche Ergebnis hat. Plattformlogiken bevorzugen zudem nicht automatisch Oberflächlichkeit – sie bevorzugen Engagement. Und das lässt sich – gegen alle gängigen Narrative und populistischen Taktiken – auch mit Substanz erzeugen.
Strategischer Perspektivwechsel: Von Output zu Beziehung
Ok, Schluss jetzt mit dem Goldfisch. Was bedeutet diese Sicht nun für Unternehmen, Institutionen und NGOs?
Meiner Meinung nach geht es nicht darum, Content um des Contents willen zu produzieren und den neuesten Trends („Weil die Trepp, weil die Treppe ist nicht genormt!“) hinterherzulaufen. Es gilt Formate zu entwickeln, die auf echte Fragen und Anliegen der Zielgruppe eingehen – in Sprache, Tiefe und Taktung. Kommunikation wird so nicht nur innerhalb der Plattformlogiken als Reichweitengenerator verstanden; Kommunikation ist vielmehr Beziehungspflege und hilft dabei einen intersubjektiven Erfahrungsraum zwischen Sendenden und Empfangenden aufzuspannen – gerade im B2B oder im öffentlichen Sektor ist langfristiges Vertrauen und gemeinsames Verständnis wichtiger als der nächste Klick.
Dabei gilt es auch Qualität und das eigene Wissen (nicht nur die Meinung) sichtbar zu machen. Formate wie Podcasts, Longreads oder Expert:innenbeiträge entfalten dann Wirkung, wenn sie auf verständliche Weise Expertise vermitteln, in einer Zeit in die universalen Menschenrechte zu Meinungen degradiert werden, jedoch gern auch Haltung zeigen können. Zudem lohnt es sich, die angewandten Messlogiken zu differenzieren. Engagement bedeutet nicht nur Likes und Impressions, sondern auch wiederkehrende Nutzung, geteilte Inhalte, qualitatives Feedback – gerade letzteres wird vor allem in KMUs oft als Quelle eines Fremdbildes unterschätzt, ist aber strategisch überaus wertvoll.
Eine weitere Devise: Plattformen kennen – und Grenzen setzen. Ja, aufmerksamkeitsgetriebene Formate wie Reels, Stories oder Carousel-Posts haben ihren Platz, müssen jedoch eingebettet sein in eine konsistente Content-Strategie mit klarer Zielsetzung und zu den normativen Leitlinien der Organisation und den kommunizierenden Personen passen.
Fazit: Aufmerksamkeit ist gestaltbar
Nicht Algorithmen diktieren unsere Kommunikation, sondern unsere Bereitschaft, Kommunikationsräume bewusst und verantwortungsvoll zu kuratieren. Das bedeutet eben weder, digitale Plattformen zu ignorieren noch sich ihren Logiken zu unterwerfen, sondern sie zu durchdringen - mit dem Ziel, Menschen zu erreichen, diese nicht nur als Nutzer:innen zu verstehen oder ihr Verhalten zu tracken. Der Weg zu einer wirksamen, menschenzentrierten Kommunikation beginnt für mich dabei mit einer einfachen, aber radikalen Frage:
„Was will ich als Organisation in der Aufmerksamkeit anderer hinterlassen – und warum ist das auch für mein Publikum wertvoll?“
PS: D. Graham Burnett geht im Hinblick des individuellen Verhaltens einen radikaleren Weg: Wir können uns als Personen immer noch aktiv dazu entscheiden, anstatt im Doomscroll zu verfallen, auf Inseln der ungeteilten Aufmerksamkeit auszuweichen – uns sogenannte „attention sanctuaries“ zu schaffen und somit auch für unsere eigene Gesundheit zu sorgen (HIER geht es zu einem interessanten Paper zu diesem Aspekt). Zusammen mit einer Vielzahl von Gleichgesinnten hat Graham daher das Kollektiv „Friends of Attention“ ins Leben gerufen und sogar eine eigene Schule in Brooklyn, New York, gegründet, die Aktivitäten und Techniken vermittelt, welche Menschen dabei helfen sollen, bewusst mit ihrer Aufmerksamkeit umzugehen. Gesammelt ist diese Haltung in den, sehr lesenswerten, zwölf Thesen zur Aufmerksamkeit zu finden. Der Lasse liebts!