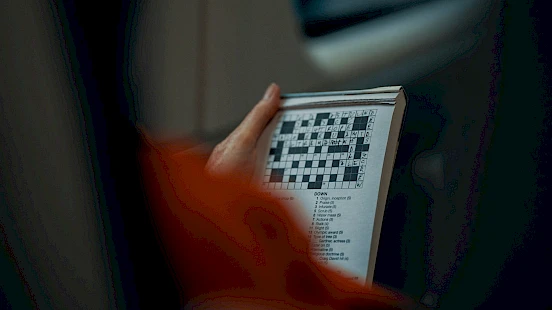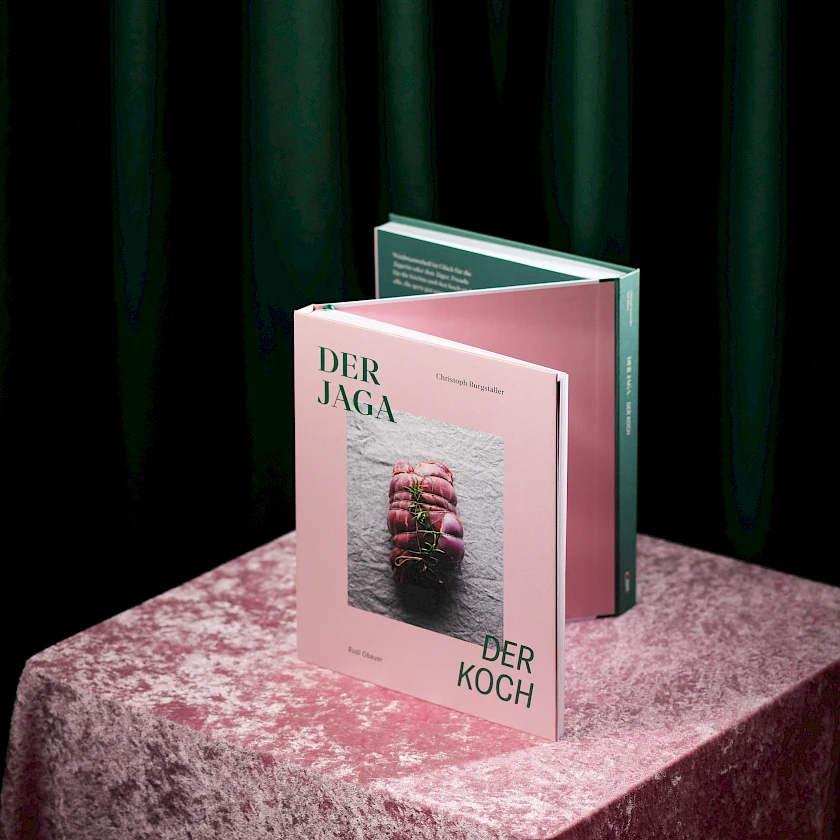Wertebasiertes Management – eine Reflexionsfläche
Die Kenntnis zentraler Markenwerte ist die Grundlage aller unserer strategischen Tätigkeiten. Ein Thema also, dem wir uns gern gründlicher widmen. Kürzlich in einem Gespräch mit einem Berater eines anderen Unternehmens kam es jedoch zu folgender Situation: Er sagte sinngemäß: „Research wird im Beratungsalltag ja immer unwichtiger, wir konzentrieren uns jetzt auf strategisches Design und wertebasiertes Management. Wertearbeit wird in Unternehmen nämlich immer relevanter!“ Genau mein Thema. Ich wollte also wissen, auf welcher theoretischen Grundlage er das mache. Zumindest was für ihn denn nun ein Wert sei. Unverständnis schlug mir entgegen. „Na das, was wir als Gesellschaft brauchen um endlich wieder vorwärts zu kommen. Sie wissen schon: Freiheit, Innovationsorientierung, Gewinnorientierung.“ Interessant.
Neben diesem schmissigen Einstieg wird der Rest des Beitrags leider etwas spröde. Wer dranbleibt wird mit folgendem belohnt:
Ich möchte mein Werteverständnis anhand einer spezifischen Position innerhalb der politischen Theorie darlegen. Der Grund ist simpel. Beratung, Branding und Entwicklung kann glaubwürdig und ergebnisoffen nur dann gelingen, wenn die Agentur selbst ein reflektiertes, pluralistisches Werteverständnis besitzt. Wenn sie kein unreflektiertes, idealisiertes Set an Werten, so wie mein obiger Gesprächspartner, mitbringt. Unternehmer:innen können zudem ihr Werteverständnis anhand dieser Zeilen aktiv reflektieren und so strategische Impulse erhalten. Aber Achtung: Die Lektüre könnte zu kognitiven Dissonanzen führen.
Freiheit, das zentrale Ideal!?
Wir alle kennen sie, die Brandrede vieler Unternehmer:innen für mehr Freiheit, weniger Restriktionen. Ein Thema, an welchem dies aktuell auch in einer breiten Öffentlichkeit sichtbar wird, ist sicher die Debatte um Meinungs- und Redefreiheit auf den großen Social Media-Plattformen. Zwei Beispiele:
Am 07. Januar 2025 postet etwa Mark Zuckerberg ein Video, in dem er beschreibt, dass Meta Platforms in Zukunft weniger third party fact checking durchführen wird und dafür „more speech“ zulasse – ein Bekenntnis für den scheinbar universalen, primären Wert der (Meinungs-)Freiheit (Kaplan 2025). Am 26. Februar 2025 wiederum schrieb Jeff Bezos, Gründer von Amazon an die Mitarbeiter:innen der Washington Post (welche Bezos seit 2013 besitzt), dass in Zukunft die Beiträge der Kommentarspalte nur noch die Themen „personal liberties and free markets“ verteidigen sollen:
„There was a time when a newspaper, especially one that was a local monopoly, might have seen it as a service to bring to the reader’s doorstep every morning a broad-based opinion section that sought to cover all views. Today, the internet does that job.“ (Bezos 2025)
Das normative Selbstverständnis einer großen Tageszeitung, als journalistisches Medium sonst an einer multiperspektivischen Darstellung pluraler Meinungen und Werte orientiert, wird somit seitens einer unternehmerischen Führung nunmehr nicht nur infrage gestellt, sondern vielmehr, qua wirtschaftlicher Gestaltungsmacht aktiv auf idealisierte Werte ausgerichtet.
Die politische Theorie hat für die Idealisierung eines einzelnen Wertes – in unserem Falle exemplarisch die persönliche Freiheit und somit auch freie Märkte – einen Begriff: Monismus.
Monismus bedeutet im Kontext von Werten nichts anderes, als dass sich ein Individuum, eine Organisation oder eben ein Staat an einem zentralen Wert (hier etwa Freiheit oder eben Gewinnmaximierung) ausrichtet und alle anderen Werte (hier bspw. Gleichheit, Gerechtigkeit, Vertrauen) der Erreichung dieses Wertes untergeordnet werden. Das Gegenteil von Monismus wird oft als Relativismus bezeichnet. Denn wenn nichts wichtiger ist als das andere, dann ist doch auch alles relativ, oder? Wollen wir mal sehen.
Wertepluralismus, ein Konzept
Im Spannungsfeld zwischen Monismus und Relativismus entwickelte der britische Philosoph Isaiah Berlin (1909 - 1997) sein Verständnis eines objektiven Pluralismus der Werte – auch als Wertepluralismus bezeichnet. Laut diesem ist es, als Mensch ebenso wie als Gesellschaft, notwendig, ein individuelles Set aus universellen, jedoch inkommensurablen, sogar teilweise unvereinbaren Werten, zueinander auszubalancieren. Die Abwesenheit eines übergeordneten Werts, als Fixpunkt der Orientierung, verböte die Ableitung von einfachen Entscheidungsregeln zur Verhandlung von Wertkonflikten. Berlin fügt verschiedentlich in seinen Argumentationen für eine Pluralität der Werte explizit eine Divergenz dieser „between cultures, or groups in the same culture, or between you and me“ und sogar „within the breast of a single individual“ (Berlin 1997a, S. 10) an, weshalb seine Theorie hier auf intra- und interpersoneller, sowie gesamtheitlich menschlicher Ebene verstanden wird.
Berlin löst in seinen Argumentationen exemplarische philosophische Positionen seit der Antike, über die Rationalisten des 17., die Empiriker des 18., bis zu progressiven Theorien des 19. Jahrhunderts von allen divergierenden Bestandteilen und legt das ihnen inne liegende Grundprinzip der Orientierung an einem einzigen Ideal frei, dem, nach Berlin, ur-platonischen Glaube an die absolute, mittels klarer Prinzipien erkennbare und in sich widerspruchsfreie Wahrheit (Berlin 1997a, S. 2 ff.; 2014, S. 5). In Bezug auf Moralfragen übersetze sich dieser in die jeweils richtigen, singulären Antworten nach der perfekten Art zu leben. Dieser, sich im Rahmen der Aufklärung von einer Idealisierung göttlicher Ordnung, hin zum Verfolgen eines Ideals der Vernunft transformierte Glaube, gehe in seinen Grundprämissen fehl. Unter Rückgriff auf Gegenaufklärer wie Vico, Herder (Berlin 1997a, S. 6 f.; 2014, S. 13) entwickelt er eine differenzierte Kritik, welche einen solchen Monismus, egal welcher Motivation, als Keim menschlichen Greuls und „at the root of every extremism“ (Berlin 2014, S. 14) identifiziert:
“[…], the search for perfection does seem to me a recipe for bloodshed, no better even if it is demanded by the sincerest of idealists, the purest of heart.” (Berlin 1997a, S. 15)
Die Verfolgung eines Ideals, eines singulär erstrebenswerten Zwecks (men’s end), führte Berlins Ansicht nach in der Ideengeschichte vielfach zu Despotismus und totalitärer (Gewalt-)Herrschaft. Diese politische Zielrichtung, etwa von Lenin, Trotsky, Mao und Pol Pot, instrumentalisiere menschliche Emotion mittels Heilsversprechungen:
„Some armed prophets seek to save mankind, and some only their own race because of its superior attributes, but whichever the motive, the millions slaughtered in wars or revolutions – gas chambers, gulag, genocide, all the monstrosities for which our century will be remembered – are the price men must pay for the felicity of future generations. If your desire to save mankind is serious, you must harden your heart, and not reckon the cost.” (Berlin 1997a, S. 13)
Zur Vermeidung dieses möglichen Ergebnisses menschlichen Handelns ist es für Berlin notwendig den Charakter menschlicher Werte und damit gleichsam erstrebenswerter ends abseits einer Vorstellung von wahren und falschen Werten umzudenken. Berlin erkennt klar die Möglichkeit an, dass menschliche Werte konfliktären Charakter besitzen, einige miteinander gänzlich unvereinbar sind und in ihren jeweiligen Ausprägungen abgewogen und ausbalanciert werden müssen (Berlin 2014, S. 10; 2014, S. 22). Ein Beispiel für seine Sicht auf diese Inkommensurabilität der Werte ist jenes des Wertepaares unserer oben angesprochen Freiheit sowie Gleichheit:
“Both liberty and equality are among the primary goals pursued by human beings through many centuries; but total liberty for wolves is death to the lambs, total liberty of the powerful, the gifted, is not compatible with the rights to a decent existence of the weak and less gifted.” (Berlin 1997a, S. 10)
In größerer sprachlicher Stringenz und im Hinblick auf die Gesamtheit der Werte drückt Berlin es in seinen Two Concepts of Liberty aus: “Everything is what it is: liberty is liberty, not equality or fairness or justice or culture, or human happiness or a quiet conscience.” (Berlin 1997b, S. 197).
Zur genauen Bestimmung menschlicher Werte bleibt Berlin jedoch vage. Er expliziert weder eine Anzahl noch die jeweilige Definition menschlicher Werte (Berlin 2014, S. 12), sondern koppelt deren Ausformung an eine Art der Intersubjektivität – an eine Art der Wahrheit und des Erkennens aufgrund geteilter Bedeutungszuschreibung – anhand der auch das Versehen anderer Menschen und Kommunikation zwischen diesen, auch konfligierenden Wertesystemen erst ermöglicht wird:
„These collisions of values are of the essence of what they are and what we are. If we are told that these contradictions will be solved in a perfect world […] then we must answer […] that the meanings they attach to that names which for us denote the conflicting values are not ours. We must say that the world in which what we see as incompatible values are not in conflict is a world altogether beyond our ken […].” (Berlin 1997a, S. 11).
Ein Grundkonflikt, eine Kollision der Werte ist somit deren ur-eigenes Wesen und die gemeinsame Anerkennung dieses Prinzips, das gemeinsame Erkennen von dessen Bedeutung, verbindet uns als Menschen. Der, sich aus diesen grundsätzlichen Ansichten ergebende notwendige Respekt gegenüber unseren Mitmenschen, das Anerkennen von individuellen Wertesets, welche keine Priorität gegenüber dem eigenen (oder vice versa) genießen, denkt bereits die Notwendigkeit einer Suche nach Kompromissen in der Entscheidung von Wertefragen weg von einem somit entstehenden defizitären und hin zu einem begründeten Ergebnis (Cherniss 2012, S. 9). Doch welche Impulse setzt dieses komplexe und theoretische Verständnis von Werten und für Organisationen? „Damit verdienen wir doch kein Geld!“ – könnte zumindest mein Eingangs genannter Gesprächspartner sagen.
Implikationen für Organisationen
Die Antwort ist zweigeteilt: Beratungen und Agenturen können auf Basis dieses Verständnis ein eigenes Wertefundament ausprägen und trotzdem auf Augenhöhe mit eher monistisch denkenden Organisationen arbeiten. Sie können deren Werte als intersubjektiv begründbar akzeptieren und empathisch mit-denken. Gleichsam sind sie so in der Lage differenzierte Fremdbilder zu entwickeln, neue Impulse zu setzen und kreative strategische Neuausrichtungen im Sinne ihrer Kund:innen zu entwickeln.
Organisationen wiederum, egal ob öffentlich, gemeinnützig oder privatwirtschaftlich, erhalten mit dem Wertepluralismus eine Möglichkeit zu reflektieren, inwiefern ihre Werte im Konflikt mit denen anderer Unternehmen, gesellschaftlichen Anspruchsgruppen oder Individuen stehen. Sie erkennen konfliktive aber auch geteilte Werte an und entwickeln so authentische Strategien. Sie werden in die Lage versetzt die Einflüsse ihres Handelns aus der Perspektive anderer zu betrachten und strategische Entscheidungen auch abseits des zentralen Markenkerns zu entwickeln und zu legitimieren.
Wichtig zu beachten: Diese Perspektive gibt uns das Handwerkzeug für einen diskursiven Austausch mit unseren Mitmenschen, auch bei unterscheidlichen Wertefundamenten. Was jedoch unumstößlich bleibt ist die Anerkennung eines gemeinsamen, verbindenden menschlichen Horizonts. Wir erkennen als Menschen unterschiedliche Werte an und versetzen uns empathisch in andere Positionen hinein und bewerten unser Handeln auf dieser Grundlage. Da wo offensichtlich menschenverachtende Werte reproduziert werden, wo Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe, ihrer Identität, Herkunft oder anderer Merkmale herabgestuft werden, hört dieser Horizont auf!
Quellen
Berlin, I., 1997a. The Pursuit of the Ideal. In: H. Hardy & R. Hausheer, Hrsg. The Proper Study of Mankind. An Anthology of Essays. London: Chatto & Windus, pp. 1-16.
Berlin, I., 1997b. Two Concepts of Liberty. In: H. Hardy & R. Hausheer, Hrsg. The Proper Study of Mankind. An Anthology of Essays. London: Chatto & Windus, pp. 191-242.
Berlin, I., 2014. My Intellectual Path. In: H. Hardy, Hrsg. The Power of Ideas. Princeton/Oxford: Princeton University Press, pp. 1-23.
Bezos, Jeff. 2025. „X Post - Washington Post“. Tweet. X https://x.com/JeffBezos/status/1894757287052362088.
Cherniss, J. L., 2012. Isaiah Berlin’s thought and its legacy: Critical reflections on a symposium. European Journal of Political Theory, 12(1), pp. 1-19.
Kaplan, J., 2025. More Speech and Fewer Mistakes. https://about.fb.com/news/2025/01/meta-more-speech-fewer-mistakes/
Foto von Luke Stackpoole auf Unsplash